Innerhalb der Co:llaboratory-Initiative „Lernen in der digitalen Gesellschaft“ haben sich Jörg Eisfeld-Reschke und Kristin Narr, gemeinsam mit Lisa-Maria Kretschmer, mit digitaler Kollaboration beschäftigt. Der Text ist im Abschlussbericht der Initiative erschienen und wird nun auch im ikosom-Blog veröffentlicht. Darüber hinaus sprachen die Autoren in der Reihe „Fachgespräche on Air“ über ihre Arbeit und Ergebnisse (Link zur Aufzeichnung).
Jörg Eisfeld-Reschke, Lisa-Maria Kretschmer, Kristin Narr
Gemeinschaftliches Lernen, also das gemeinsame und zielgerichtete Lernen, Denken und Arbeiten in einer Gruppe, ist Kollaboration. Und Kollaboration ist gemeinschaftliches Lernen, da die beteiligten Personen sich in einem Prozess des Austausches und der Reflexion befinden.
Dem Kollaborationsbegriff liegt die aus dem Lateinischen (collaborare) stammende Bedeutung „zusammenarbeiten“ zugrunde. Davon ausgehend ist Kollaboration definiert als Zusammenarbeit von Individuen auf Basis einer Kooperation und geschaffenen Koordinations- und Kommunikationsvoraussetzungen unter Berücksichtigung der organisationalen und persönlichen Kontexte. Jede Kollaboration beruht auf Kooperation, der gemeinsame Absprachen und Konventionen zugrunde liegen, die die Zusammenarbeit regeln. Je nach Koordinationsgrad (Organisations- strukturen, Standardisierung von Produkten, Prozessen und Qualikationen) und Kommunikationskonventionen (synchron/asynchron, Feedbackschleifen) kann die Kollaboration verschiedene Intensitätsgrade annehmen (vgl. Behm 2009).
Menschen streben seit jeher danach, sich mit anderen zusammenzuschließen und gemeinsam aktiv zu werden. Nicht dieses Streben nach Kollaboration ist neuartig, sondern die Vielfalt an Technologien, dieses Vorhaben zu realisieren: Mittels technologischer Werkzeuge schließen wir uns mit neuer Leichtigkeit mit bekannten und unbekannten Personen zusammen – und das unabhängig von Ort und Zeit. Findet die Zusammenarbeit mit digitalen Medien und in (teil-)virtuellen Umgebungen statt, spricht man von digitaler Kollaboration.
Digitale Medien haben keinen Selbstzweck: Durch sie sind wir in der Lage, Umgebungen nach unseren Bedürfnissen zu kreieren und für unsere Zwecke in Gebrauch zu nehmen. Sie werden also je nach Kontext mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt und können sowohl eine Erweiterung der Offlinezusammenarbeit als auch eine Plattform für alle gemeinsamen Arbeitsprozesse darstellen.
Bei der Betrachtung digitaler Zusammenarbeit stehen oftmals konkrete Werkzeuge und Instrumente im Vordergrund. Die Fragen sind vorrangig praxisorientiert und konzentrieren sich auf geeignete Anwendungen. Die Tools, Instrumente und Formen digitaler Kollaboration sind zweckgebunden und stehen in bestimmten Zusammenhängen. Daher rückt eine intensivere und übergeordnete Beschäftigung der damit verbundenen Voraussetzungen, Herausforderungen und Nutzen in den Mittelpunkt dieser Betrachtung.
Voraussetzungen digitaler Kollaboration
Kollaboration – analog wie digital – basiert auf einem positiven Menschenbild, das die Fähigkeit und Bereitschaft zu vertrauen, zu sozialem Denken und zu einem kollektiven Miteinander umfasst. Hinzu kommen der Wunsch und die Zustimmung, mit anderen zusammenzuarbeiten, mit ihnen zu teilen sowie die eigenen Arbeitsprozesse an den Bedürfnissen einer Gruppe auszurichten. Die Motivation dafür basiert auf einer individuellen Überzeugung, dass durch diese Form Zusammenarbeit effektiver und geeigneter erfolgen kann.
Um im digitalen Umfeld kollaborieren zu können, müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen, Hardware zur Verfügung gestellt und ein gemeinsamer Zugang zu Instrumenten bereitgestellt werden. Je nach Intensität der digitalen Kollaboration sind auch der Zugang und die Bearbeitung derselben Arbeitsversion für die Zusammenarbeit notwendig.
Ausgehend von dieser funktionierenden technischen Infrastruktur können Verantwortungs- und Zuständigkeits-, aber auch Abhängigkeitssysteme neu ausgestaltet werden. Digitale Kollaboration ermöglicht dem Einzelnen und der Gruppe die Möglichkeit, selbstbestimmt und selbstverantwortlich im eigenen Tempo zusammenzuarbeiten. Sie setzt aber gleichzeitig eine gemeinsame Arbeitsorganisation und definierte Zuständigkeiten und Absprachen des Einzelnen und der Gruppe voraus. Das durch technische Veränderungen angestoßene Überprüfen klassischer Strukturen und die davon ausgehende Reorganisation von Gruppen ermöglicht die Veränderung von Hierarchien und je nach Intensität der Kollaboration das Testen neuer Abläufe und Formen der Zusammenarbeit.
Dies setzt jedoch voraus, dass die Gruppenmitglieder über individuelle Kompetenzen im Umgang mit digitalen Umgebungen und Instrumenten verfügen. Sowohl die Fähigkeiten zur Bedienung digitaler Instrumente als auch das notwendige Verständnis wird zumindest im geringen Maße vorausgesetzt. Für jene Personen, die in digitaler Kollaboration noch ungeübt sind, stellt sich im Besonderen die Herausforderung, einen Umgang mit dem potenziellen Informationsüberfluss und der Beschleunigung des Austauschens zu finden.
Digitale Kollaboration versetzt den Einzelnen und u.U. die Gruppe in eine stetige Reflexion über den eigenen Arbeitsprozess – ob bewusst oder unbewusst. Das meint zum einen, dass Einzelne sich als Bestandteil innerhalb eines gemeinsamen Prozesses wahrnehmen und sich in ihre Rolle und Aufgabe einfinden, und zum anderen, dass gängige Mechanismen, beispielsweise persönliche Vorgehensweisen, hinterfragt und möglicherweise aufgegeben werden.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zu den Voraussetzungen digitaler Kollaboration zählt, Arbeitsprozesse an den gemeinsamen Bedürfnissen auszurichten und zu verhandeln. Neben den technischen Voraussetzungen (z.B. Hardwareaus- stattung, Internetzugang, Zugang zu digitalen Instrumenten) müssen auch soziale Faktoren (z.B. Verantwortung, Zuverlässigkeit, Kompromissbereitschaft) gegeben sein. Auf der individuellen Ebene setzt digitale Kollaboration die Fähigkeiten voraus, die digitalen Instrumente für sich in den Gebrauch nehmen zu können, gleichermaßen für andere nutzbar zu machen und den eigenen Arbeitsprozess durch die Wahrnehmung bzw. die Teilhabe an anderen Arbeitsprozessen zu reflektieren.
Herausforderungen digitaler Kollaboration
Wie bereits deutlich wurde, ist der Einsatz digitaler Instrumente in Kooperation und Kollaboration voraussetzungsreich für die beteiligten Personen und die Strukturen, in denen sie agieren. Anders als bei neuen Gruppen, die ohnehin gemeinsame Ver- abredungen für die Zusammenarbeit treffen müssen, fallen die Veränderungskosten für bestehende Gruppen deutlich ins Gewicht. Bestehende Arbeitsprozesse müssen übertragen und auf die Notwendigkeit von Anpassungen an den digitalen Workflow hin untersucht werden.
Die Heranführung an die Nutzung digitaler Instrumente geht in der Regel einher mit Fortbildungen und Übungen, welche die Kapazitäten zumindest in der ersten Zeit binden. Eine Gruppe wird erst dann wieder eine hohe Effzienz erreichen, wenn alle Mitglieder ein ausreichend hohes Anwendungsniveau erreicht haben. Andernfalls ist die Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
In der Regel beschränkt sich der Einsatz digitaler Medien nicht auf ein einzelnes Instrument, sondern auf ein Set an Instrumenten, deren Verwendung zunächst auf- einander abgestimmt werden muss. Für die Sicherstellung einer gemeinsamen und effzienten Verwendung werden zusätzliche Ressourcen in einer Moderation gebun- den, die zu einem gemeinsamen Verständnis, einer einheitlichen Nutzungsweise und aufeinander abgestimmten Prozessen führen soll.
Das deutsche Urheberrecht sieht vor, dass dem Urheber eines Werkes bzw. einer geistigen Schöpfung jegliche Rechte vorbehalten sind. Für den Fall, dass mehrere Personen an einem Werk beteiligt sind, gelten sie laut Urheberrechtsgesetz § 8 Abs. 2 als Miturheber. Änderungen am gemeinsamen Werk sind nur mit Zustimmung der Miturheber zulässig. Diese dürfen jedoch ihre Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und Glauben verweigern. Vor dem rechtlichen Hintergrund scheint es unabdingbar, weitergehende Vereinbarungen hinsichtlich der Weiterverwendung in Kollaboration entstandener Werke zu treffen.
Zu Recht werden beim Einsatz digitaler Instrumente Befürchtungen einer möglichen Verhaltens- und Leistungskontrolle laut. Überarbeitungsverläufe und Zeitstempel machen die Überprüfung und Zuordnung von Aktivitäten – wer trägt wann und wie viel bei – vermeintlich einfach. Diese Annahme ist insofern berechtigt, dass zumindest eine soziale Leistungskontrolle auch im digitalen Raum stattfindet. Für eine tatsächliche Leistungskontrolle sind die Nutzungsdaten digitaler Instrumente keinesfalls ausreichend. Sie können stets nur jenen kleinen Ausschnitt der Aktivitäten darstellen, die in gemeinsamen Instrumenten stattfinden. Für eine formale Einbeziehung digitaler Nutzungsdaten wäre ohnehin eine Mitbestimmungspflicht bindend sicherzustellen.
Nutzen digitaler Kollaboration
Selbst wenn eine Reihe von strukturellen, technologischen und sozialen Voraussetzungen erst geschaffen werden müssen, deren Etablierung Ressourcen bindet, kann sich diese Investition langfristig auszahlen.
Die Technologien erleichtern nicht nur die Vernetzung mit bekannten und unbekannten Personen, sondern anschließend ebenfalls – sobald neue organisationale Strukturen geschaffen und Zuständigkeiten geklärt sind – die Koordination gemeinsamer Aktivitäten. Gruppeninterne Kommunikation und Absprachen werden vereinfacht, da jeder potenziell über den Zugang zu relevanten Informationen verfügt und so Zeitverlust durch umständliche Kommunikationsschleifen minimiert wird. Nicht nur Kosten für Arbeitsräume und (Informations-)Transaktionen sinken, auch Frustration über Missverständnisse und dadurch entstehende Mehrarbeit kann vermieden werden.
Selbst inhaltlich zeichnen sich Vorteile ab – Stichwort: kollektive Intelligenz. Hat sich ein Team gebildet, stehen die individuellen Erfahrungen, das Wissen und Know-how zentral gebündelt zur Verfügung. ldeen können in Echtzeit mitgeteilt und durch das Feedback der Gruppe unmittelbar weiterentwickelt werden. Ein kurzes Nachfragen oder selbst nur die Kommunikation über einen Sachverhalt löst Denkblockaden und die eigene Argumentationslogik wird schon während des Entwicklungsprozesses auf die Probe gestellt. Durch die Vernetzung von Denken und Arbeiten kann eine Gruppe die Entstehung, Entwicklung und die konkrete Umsetzung von Ideen und Projekten von Beginn an gemeinsam erleben und so im Prozess miteinander und voneinander lernen.
Dies fördert nicht nur eine positive Teamdynamik, auch auf individueller Ebene wirkt diese Art der Zusammenarbeit motivierend. Zum einen wird durch die Möglichkeit – oder mehr noch Aufforderung – zur Partizipation der Einzelne in dem Gefühl bestärkt, dass die eigene Meinung gefragt ist und er auf das Gelingen eines gemeinschaftlichen Projekts tatsächlich einen Einfluss hat. Zum anderen sind aufgrund des transparenten Entstehungsprozesses Entscheidungen nachvollziehbar und stoßen somit potenziell auf mehr Verständnis und Akzeptanz.
Weiterhin ist – gegeben sei der technische Zugang – im digitalen Umfeld eine hier- archiefreiere Zusammenarbeit möglich. Im Analogen können ab einer bestimmten Gruppengröße die Mitglieder nicht mehr direkt interagieren. Um Aufgaben mit einer großen Anzahl an Beteiligten zu realisieren, ermöglichen klassische Management- und Kontrollstrukturen Kommunikation und Koordination mit möglichst geringem Aufwand. Mittels neuer Technologien lässt sich nun die Organisation dezentral auf vielen Schultern verteilen, wodurch traditionelle hierarchische Organisationsstrukturen obsolet werden. Die Möglichkeit, dabei anonym zu bleiben, verschafft zudem zu Beginn der Zusammenarbeit eine Freiheit, sich als Gleicher unter Gleichen zu bewegen. Nicht Alter, Geschlecht, Rang und Ethnizität stehen im Mittelpunkt. Viel- mehr erlangt man in der Gruppe im Laufe der weiteren Kollaboration Status und Anerkennung durch das stärkste Argument.
Je nach Intensität wird durch digitale Kollaboration die Effektivität von (Lern-)Prozes- sen gesteigert: durch die zentrale Bündelung von individuellen Erfahrungen, Wissen und Know-how, durch eine vereinfachte dezentrale Organisation und Koordination sowie durch eine hohe Motivation in der Gruppe und auf persönlicher Ebene durch die Chance auf Einflussnahme auf Entscheidungen und deren Transparenz.
Abschließende Betrachtung
Die analysierten Voraussetzungen für digitale Kollaboration, die Herausforderungen und der Nutzen digitaler Instrumente machen deutlich, dass es sich um ein viel- schichtiges und komplexes Phänomen handelt. Ein Phänomen, das aufwendig und ressourcenbindend ist. Die Herausforderungen sind bestimmt durch Umstellungen und Veränderungen der Arbeits- und Lernprozesse. Dennoch oder gerade deswegen stecken in digitaler Kollaboration Potenziale, die sich langfristig für den Menschen und die Gemeinschaft auszahlen.
Dabei geht es nicht darum, analoge durch digitale Instrumente zu ersetzen, sondern unterschiedliche Möglichkeiten je nach Kontext und Umgebung sinnvoll und gewinnbringend einzusetzen und nutzbar zu machen.
Das Bekannt- und Bewusstmachen der Herausforderungen und lösungsorientiertes Herangehen sind dabei die Schlüssel, die digitale Kollaboration ermöglichen. Dafür ist es nötig, die unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten positiv einzubinden und nutzbar zu machen, den Einzelnen als Teil der Gruppe mit Aufgaben und Zuständigkeiten zu verstehen und eine stetige Reflexion der Arbeitsprozesse anzustreben.
Im vermeintlichen Widerspruch – gemeinschaftlich individuell lernen – liegt der große Nutzen digitaler Kollaboration. Die gemeinsame Ausgestaltung des Weges, begleitet durch Aneignung und Reflexion von Instrumenten und Umgebungen, führt zu einem Miteinander- und Voneinanderlernen unter allen Beteiligten.
Quellen und weiterführende Literatur
Behm, Astrid (2009): Ein formaler Rahmen zur Beschreibung von Kollaborationssituationen im Softwareentwicklungsprozess – Umgebungsparameter als Auswahlkriterien für CSCW-Werkzeuge. Dissertation. Universität Karlsruhe. Online verfügbar unter: http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000011862, Stand: 12.03.2013.
Eine Studie der Forschungsgruppe Kooperationssysteme an der Universität der Bundeswehr München liefert Erkenntnisse zu Zusammenarbeitskontexten, Intensitätsstufen von Kollaboration sowie dem eingesetzten Werkzeugmix.
Denner, Jonathan/Koch, Michael (2012): Digitale Team-Zusammenarbeit in jungen, innovativen Unternehmen – Eine qualitative Interview-Studie. Online verfügbar unter:http://www.soziotech.org/digitale-team-zusammenarbeit-in-jungen-innovativen-unternehmen-eine-qualitative-interview-studie/, Stand:16.02.2013.
Warum aus sozialpsychologischer Sicht das Lernen in Gruppen zu einer höheren Motivation führt und welche Rahmenbedingungen für Gruppenprozesse geschaffen werden müssen, wissen Dieter Frey und Martin Inle, Professoren für Sozialpsychologie.
Frey, Dieter/Inle, Martin (Hrsg.) (2008): Theorien der Sozialpsychologie. Soziales Lernen, Interaktion und Gruppenprozesse: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien. Band 2. Bern/Göttingen: Huber.
Clay Shirky beschreibt, wie und warum durch digitale Kollaboration Aufgaben schneller, effizienter und hierarchiefreier gelöst werden können. Shirky, Clay (2008): Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organization. New York: Penguin Books.
James Surowiecki begründet, warum Gruppen bessere Entscheidungen treffen als Individuen. Er stellt Problemtypen und Voraussetzungen zur erfolgreichen Problemlösung in Gruppen dar und illustriert seine theoretischen Denkanstöße mit Praxisbeispielen aus Unternehmen, Märkten und Demokratie.
Surowiecki, James (2005): The wisdom of crowds. London: Abacus.




 Vom 16. bis 17. Mai erprobte ich bei der Akademie für Publizistik ein neues Seminarkonzept
Vom 16. bis 17. Mai erprobte ich bei der Akademie für Publizistik ein neues Seminarkonzept 



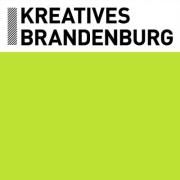 Am 6. Mai veranstalteten ikosom, das Regionalbüro Berlin-Brandenburg der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung,
Am 6. Mai veranstalteten ikosom, das Regionalbüro Berlin-Brandenburg der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, 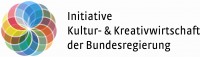 Anschließend wurde ein Workshop durchgeführt. Stephan Popp von Vision Bakery und Anna Theil von Startnext gaben den insgesamt 90 Teilnehmer_innen in zwei Gruppen praktische Hinweise zur Präsentation eines Projekts auf einer Plattform. Speziell wurden die Budgetplanung, die Gestaltung von Video und Text sowie die Auswahl der Gegenleistungen diskutiert, wobei immer wieder betont wurde, dass alle Entscheidungen dazu sehr projektindividuell getroffen werden müssen.
Anschließend wurde ein Workshop durchgeführt. Stephan Popp von Vision Bakery und Anna Theil von Startnext gaben den insgesamt 90 Teilnehmer_innen in zwei Gruppen praktische Hinweise zur Präsentation eines Projekts auf einer Plattform. Speziell wurden die Budgetplanung, die Gestaltung von Video und Text sowie die Auswahl der Gegenleistungen diskutiert, wobei immer wieder betont wurde, dass alle Entscheidungen dazu sehr projektindividuell getroffen werden müssen.

